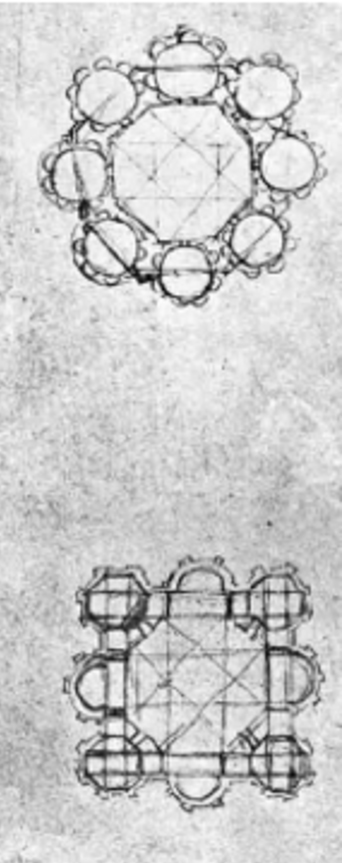Der Kirchturm, wieder habe ich mich hinauf gewagt. Unten liegt der Marktplatz da als quadrierter Sternenhimmel. Fackeln leuchten. »Oder sind es Laternen«, meint der Faun und lehnt sich so weit über die Brüstung, dass der Zentaur ihn festhalten muss: »Wie oft haben wir das gesehen, die Reden, das Schwenken der Plakate, die Parolen, Sprechchöre und die Hände, die sich ins Firmament schrauben, wo doch nur Planeten irren.« – Die Monster sind aufgebracht, es liegt etwas in der Luft. Die Demonstrationen häufen sich. Die Blicke gehen hin und her, ohne Halt zu finden, der Greif schlägt mit den Flügeln, der Ziegenwolf scharrt mit den Hufen.
Ich setze an zu einer beruhigenden Rede, aber, unsicher, welche Bahn ich einschlagen soll, breche ich schnell wieder ab. Man möchte den Faun an den Hörnern packen, der unablässig hin und her trippelt. »Es wird sich zeigen«, sagt der Zentaur, »erst werden Fahnen geschwenkt, dann Menschen gehängt.« Nicht einmal die Affen lachen. »Wir sind ziviler jetzt«, sagt der Greif. So hofft jeder auf seine Weise. Unten indes potenziert sich der Lärm, Blaulicht lodert auf. Bald wird kein Halten mehr sein. »Eine einfache Gleichung: wenn man das Problem nicht an der Wurzel packt, wird man es niemals los – « Alles weitere geht unter im Tumult, in dem der Marktplatz nun versinkt.
Helikopter schrauben sich näher wie tausend galoppierende Rosse, wir suchen nach Deckung, wir schreien, doch ist es schon zu laut für Worte, Scheinwerfer streuen ihre Maße aus; wir erstarren: Federn zu Granit, Fleisch zu Basalt, Fell zu Sandstein. Man kann nicht fliehen, man kann nicht entkommen. Wir alle leben unter dem Unstern, unter diesen Vorzeichen, es gibt keine Flucht. Ein Abkommen besiegelte mein unwahrscheinliches Schicksal und stieß doch die Türen weit auf in unbekannte Räume; so lebt die Republik hin, aber es geschieht, was wahr ist, und soll die Welt drüber vergehen.